Hier finden Sie eine kleine Auswahl unserer Forschungsprojekte.
Super nachhaltig und super funktional: Pilzmyzel ist ein Gamechanger in der Biowerkstoffentwicklung und ein zentrales Forschungsthema am Fraunhofer WKI. Mit dem Projekt »LuminousNetworks« möchten wir die faszinierenden Möglichkeiten von pilzmyzelbasierten Materialien einer breiten Öffentlichkeit nahebringen. Der bildende Künstler Malte Taffner nutzt unser technologisches Know-how, um Skulpturen aus Holzresten und lebendigem Myzel zu erschaffen. In seiner künstlerischen Auseinandersetzung verknüpft Malte Taffner technische Forschungsinnovationen mit aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen. Ziel des Projekts ist eine Ausstellung der Kunstinstallation mit ergänzendem Begleitprogramm aus Workshops und Podiumsdiskussion sowie eine Videodokumentation.
mehr Info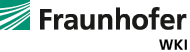 Fraunhofer-Institut für Holzforschung
Fraunhofer-Institut für Holzforschung 








